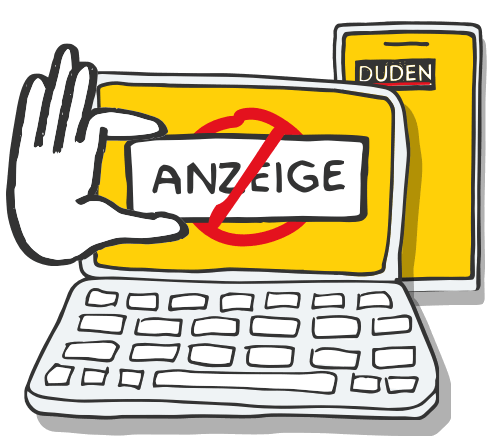Heißt es der Virus oder das Virus? Woher kommt das Wort Ostern? Und wie schreibt man eine Professorin im Brief richtig an? Ob Grammatik, Rechtschreibung, Wortherkunft oder guter Stil: Die folgenden Seiten halten Hintergrundwissen zur deutschen Sprache bereit. Die beliebtesten Artikel haben wir in einer Liste zusammengetragen.
Neuste Artikel
Herkunft von „kaufen“
Wer sich verraten und verkauft fühlt, ist deshalb mit seinem Latein noch lange nicht am Ende, zumindest nicht, was das Verb verkaufen bzw. das darin enthaltene kaufen angeht. Erfahren Sie mehr über die Herkunft von kaufen.
Weise und Waise – Homofone mit „ei“ und „ai“
In diesem Artikel klären wir, weshalb im Deutschen Wörter wie Weise und Waise nebeneinanderstehen.
Bindestrich als Ergänzungsstrich
Der Bindestrich kann nicht nur Wörter verbinden, sondern er hat auch noch andere wichtige Funktionen.
Unterschiede zwischen starken und schwachen Verben
Fällt Ihnen auch manchmal auf, dass neben den Formen du kaufst, er kauft oft auch die Formen du käufst, er käuft verwendet werden? Warum diese umgelauteten Formen des Verbs kaufen nicht korrekt sind, lesen Sie in diesem Artikel.
Synonyme für „verkaufen“
Verschachern, verscherbeln, verkloppen – seit das Kaufen und Verkaufen von Waren einen großen Teil des menschlichen Lebens bestimmen, kennen Sprachen unzählige Ausdrücke für diese Vorgänge.
Worttrennung bei geografischen Namen
Danach geht es um das, was eigentlich zusammengehört, aber gelegentlich doch getrennt werden muss, zum Beispiel am Zeilenende. Die Frage ist nur, wie?
Ableitungen geografischer Namen auf „er“ und „[i]sch“
Was politisch oder geografisch zusammengehört, ist ja nicht selten umstritten. Das gilt auch für die Getrennt- oder Zusammenschreibung oder die Schreibung mit Bindestrich von geografischen Bezeichnungen wie Französisch-Guayana, Vierwaldstätter See o. Ä.
Der Umfang des deutschen Wortschatzes
Wie umfangreich ist der aktuelle deutsche Wortschatz? Und wie viele Wörter benutzt ein deutscher Sprecher oder eine deutsche Sprecherin im Durchschnitt?
Auflösung von Partizipgruppen
Wenn in der Schule (oder auch später) aus Fremdsprachen übersetzt wird, gibt es meist eine Konstruktion, die deutschen Muttersprachlern besondere Schwierigkeiten bereitet, nämlich die Partizipgruppe.
Deklination von „Nachbar“: Wie lautet der Genitiv?
Lesen Sie ein paar Bemerkungen zu Ihren Nachbarn.