Das Dudenkorpus ist eine umfangreiche Zusammenstellung elektronischer Texte, wie Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Romane, Reden, Reparatur- und Bastelanleitungen usw., das auch die Wortschätze verschiedenster Fachgebiete abdeckt (z. B. Biologie, Chemie, Informatik, Medizin, Technik, Wirtschaft). Es enthält mittlerweile rund sechs Milliarden Wortformen und dient der Dudenredaktion als Grundlage zur Beobachtung des „echten“ Sprachgebrauchs. Bei der täglichen Recherche im Rahmen der Wörterbucharbeit fungieren die Texte bzw. Textteile als Belegquelle. Einige Beispiele:
Eine Redakteurin oder ein Redakteur muss, um den entsprechenden Wörterbuchartikel zu schreiben, entscheiden: Heißt es „das Loft“ oder „der Loft“? Schreibt man „Fakenews“ oder „Fake News“? Werden manche Ausdrücke vor allem in bestimmten Regionen gebraucht? Verwendet man heute in Zeitungstexten „wegen“ häufig mit dem Dativ? Welche Schreibung überwiegt, wenn mehrere Varianten möglich sind?
Außerdem kann die Redaktion auf der Basis des Korpus neue Erkenntnisse in Bezug auf die Häufigkeit bestimmter sprachlicher Strukturen gewinnen, so z. B., welche die häufigsten Verben im Deutschen sind oder welcher Fehlertypus besonders oft anzutreffen ist.
Vor allem hilft das Korpus dabei, bislang unbekannte Wörter aufzuspüren, die unter bestimmten Voraussetzungen neu in die Duden-Wörterbücher aufgenommen werden können. Mehr zum Aufnahmeprozess lesen Sie auf der Seite „Wie kommt ein Wort in den Duden?“.
Unsere Partner
Für die Zusammenstellung und die kontinuierliche Erweiterung des Korpus sind wir auf Partner angewiesen, die uns Texte zur Verfügung stellen. Eine Auswahl dieser Partner in alphabetischer Reihenfolge:

Berliner Zeitung

Berner Zeitung

Der Spiegel

Die Presse

Edition Atelier

Emons

Freie Presse

Junge Welt

Kölner Stadt-Anzeiger
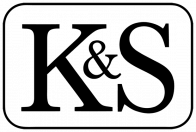
Kremayr & Scheriau

Leipziger Volkszeitung

Linde

Luxemburger Wort

Mannheimer Morgen
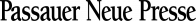
Passauer Neue Presse
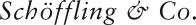
Schöffling & Co.
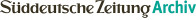
Süddeutsche Zeitung

Ventil Verlag

Zytglogge